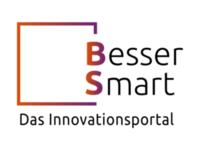INDIGO macht das Fliegen leiser und sauberer
Im internationalen Forschungsprojekt INDIGO arbeitet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Research Airport Braunschweig an der Zukunft des Fliegens: leisere, emissionsärmere und intelligentere Flugzeuge für die Kurz- und Mittelstrecke. Das Ziel: Den Flugverkehr in Flughafennähe deutlich klimafreundlicher und weniger belastend für Anwohnerinnen und Anwohner zu gestalten – durch ein innovatives Flugzeugdesign mit hochgestreckten Flügeln und hybrid-elektrischen Antrieben.
„Wir wollen die Emissionen und den Fluglärm in Flughafennähe nicht nur besser vorhersagen können, sondern auch tatsächlich senken“, erklärt Samuel Schnell, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik (Öffnet in einem neuen Tab) des DLR am Research Airport Braunschweig (Öffnet in einem neuen Tab). Schnell beschäftigt sich dort mit numerischen Strömungssimulationen und dem Flugzeugentwurf. Das DLR leitet im EU-Projekt INDIGO (Öffnet in einem neuen Tab) das Arbeitspaket zur vereinfachten Modellierung neuer Flugzeugkonzepte – mit dem Fokus auf Aerodynamik, Aeroakustik und effizienter Antriebstechnik.
Leiser Antrieb, saubere Technik
Herzstück des Konzepts ist der sogenannte DHEP-Antrieb: Distributed Hybrid Electric Propulsion. Dabei handelt es sich um mehrere über die Flügel verteilte Propeller, wobei die äußeren elektrisch betrieben werden; gespeist durch Batterien und unterstützt durch eine Gasturbine, die wahlweise mit Kerosin oder nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) läuft und sowohl den inneren Propeller antreibt als auch die Batterien wieder aufladen kann. Dieses hybride System erlaubt es, in Flughafennähe rein elektrisch – und damit emissionsfrei – zu fliegen, während für größere Reichweiten vor allem im Reiseflug auf die konventionellen Triebwerke zurückgegriffen wird.
„Wir setzen bei INDIGO auf hybrid-elektrische Antriebe. Das heißt, wir haben einerseits Batterien und Elektromotoren verbaut, zusätzlich aber auch noch klassische Turboprops mit fossilen Kraftstoffen“, beschreibt Schnell das Konzept. Die zahlreichen, großflächigen Propeller sorgen nicht nur für leiseren Betrieb, sondern verbessern auch die Steuerbarkeit und Effizienz des Flugzeugs.
Zwischen Simulation und Realität
Der Entwurf des neuen Flugzeugs erfolgt vollständig digital. Mit Hilfe sogenannter Low-Fidelity-Modelle optimieren die Forschenden zunächst die Grundstruktur. Später folgen detaillierte numerische Simulationen, etwa zur Interaktion von Propeller und Tragfläche oder zum entstehenden Lärm. „Nachdem wir die Low-Fidelity-Methoden entwickelt haben, um den grundlegenden Entwurf des Flugzeugs zu machen, verfeinern wir schrittweise die Methoden“, so Schnell.
Die Digitalisierung hat auch in der Luftfahrtforschung einen Quantensprung gemacht – die Gesamtflugzeug-Simulationen erfolgen auf Hochleistungsrechnern. „Für den Flugzeugvorentwurf muss man inzwischen gar nicht mehr in den Windkanal“, bestätigt Schnell. „Ich rechne von Braunschweig aus auf einem Hochleistungsrechner des DLR in Göttingen (Öffnet in einem neuen Tab).“ Im Windkanal werden nur Detailfragen des INDIGO-Konzepts untersucht.
Realistische Ziele mit Kompromissen
Trotz des Hightech-Ansatzes ist sich das Team bewusst, dass Innovation in der Luftfahrt immer ein Balanceakt ist. Fluglärm senken, ohne die Effizienz zu verlieren? Niedriger fliegen, ohne an Reichweite zu verlieren? Jede Entscheidung hat Auswirkungen. „Eine der größten Herausforderungen ist, wie man mit untereinander in Konflikt stehenden Zielen umgeht“, sagt Schnell. „Wenn man den Lärm eines Flugzeugs mindert, sich dadurch aber der Treibstoffbedarf erhöht – wie findet man hier das Optimum?“
Bisher sieht die Bilanz vielversprechend aus. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Airbus A320 konnte bei den Modellrechnungen des INDIGO-Prototyps der Treibstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß in Flughafennähe deutlich gesenkt werden. Die Reichweite des aktuellen Konzepts liegt bei rund 1800 Kilometern – ideal für innereuropäische Strecken. Die Reisegeschwindigkeit beträgt etwa 740 km/h – etwas weniger als bei einem klassischen Jet, was dem Propellerantrieb geschuldet ist.
Blick in die Zukunft
INDIGO will nicht nur ein neues Flugzeug entwerfen, sondern auch neue Bewertungsmethoden für Emissionen und Lärm etablieren. Mit präzisen Lärmkarten und Emissionsmodellen sollen Auswirkungen auf die Umwelt besser vorhergesagt und politisch berücksichtigt werden können. „Wir werden in Zukunft Lärmkarten und Emissionskarten erstellen, auf denen man sehen kann, wie sich der Lärm und die Emissionen verändern, wenn man dieses neue Fluggerät in der Flotte einsetzt“, kündigt Schnell an.
Die Forschenden sind überzeugt: Auch wenn Batterien aktuell noch nicht mit der Energiedichte von Kerosin mithalten können und Wasserstoff deutlich mehr Volumen benötigt, ist der Weg in Richtung elektrisches Fliegen alternativlos. „Wir werden uns auf jeden Fall in Richtung elektrisches Fliegen bewegen – aber wahrscheinlich in den meisten Fällen noch hybrid“, sagt Schnell. Die Erkenntnisse aus INDIGO könnten so den Grundstein legen für ein neues Kapitel der Luftfahrt – leiser, grüner und intelligenter.
Text: Stephen Dietl, 30. Juli 2025