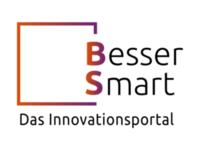Die Zukunft des Bauens ist digital
Die Baustelle der Zukunft steht nicht mehr nur für Stahl, Beton und laute Maschinen – sondern auch für Sensorik, 3D-Druck und datengetriebene Prozesse. Mit ihrem Projekt „Die Digitale Baustelle“ macht sich die Technische Universität Braunschweig daran, den innovationsbedürftigen Bausektor in eine digitale und nachhaltige Zukunft zu führen.
In kaum einem anderen Wirtschaftszweig ist der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit so groß wie im Bauwesen. Während andere Branchen längst digitalisiert sind, bleibt der Bau oft analog, mit all den bekannten Problemen: ineffiziente Abläufe, hohe Materialkosten, Fachkräftemangel und Sicherheitsrisiken. Die TU Braunschweig (Öffnet in einem neuen Tab) will das ändern. Mit dem Projekt „Die Digitale Baustelle – Bauindustrie 4.0 (Öffnet in einem neuen Tab)“ wird derzeit eine hochmoderne Forschungsumgebung geschaffen, in der digitale Technologien unter realen Baustellenbedingungen erprobt werden.
Alte Probleme, neue Antworten
Herzstück ist ein über 2.800 Quadratmeter großes Versuchsareal auf dem Campus Ost. Dort vereinen sich verschiedenste digitale Großgeräte: ein sechs Meter hoher 3D-Betondrucker, mobile Roboter, automatisierte Betonmischanlagen, Trackingsysteme und eine immersive Virtual-Reality-Wand. In dieser Hightech-Kulisse sollen traditionelle Prozesse wie das Mauern, Mischen und Montieren durch datenbasierte Verfahren ersetzt oder zumindest unterstützt werden.
„Die digitale, robotische Fertigung könnte ein Schlüssel zur Zukunft des Bauens sein“, erklärt Professor Patrick Schwerdtner, Projektleiter für die Beschaffung der Infrastruktur und Leiter des Instituts für Bauwirtschaft und Baubetrieb (Öffnet in einem neuen Tab) an der TU Braunschweig. Der Forscher sieht darin eine echte Chance, die Herausforderungen der Branche nachhaltig zu lösen: „Wir müssen effizienter, sicherer und nachhaltiger bauen. Das schaffen wir nur mit digitalisierten, vernetzten und teilweise automatisierten Prozessen.“ Hierzu bedürfe es interdisziplinärer Ansätze. Beteiligt am Projekt sind daher auch das Institut für Tragwerksentwurf (Öffnet in einem neuen Tab), das Institut für Geodäsie und Photogrammetrie (Öffnet in einem neuen Tab) sowie das Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (Öffnet in einem neuen Tab).
Additive Fertigung und 3D-Druck als Schlüsseltechnologie
Zentrales Gerät der neuen Baustellenrealität ist ein 3D-Betondrucker. Anders als bei konventionellen Verfahren wird der Beton damit nicht in Schalungen gegossen, sondern schichtweise aufgebaut – formfrei und punktgenau. Das spart Material, senkt Emissionen und ermöglicht völlig neue geometrische Formen. „Wir wollen ressourceneffizienter bauen, also Beton nur dort einsetzen, wo er statisch notwendig ist“, sagt Schwerdtner. Als Beispiel nennt er das Schienbein des Menschen: außen stabil, innen hohl – aber dennoch extrem tragfähig.
Im Zusammenspiel mit der sogenannten „Mobile Digital Concrete Plant“, einer digital gesteuerten Misch- und Pumpanlage, entsteht so eine durchgehende Prozesskette: vom digitalen Entwurf über die automatisierte Produktion bis hin zur Echtzeitüberwachung mittels Sensorik. Diese Integration erlaubt es, nicht nur exakter, sondern auch schneller und sicherer zu bauen. Komplexe Bauteile, die bisher Wochen dauerten, lassen sich in Stunden drucken.
Die TU Braunschweig greift dabei auf Erkenntnisse aus dem Sonderforschungsbereich TRR 277 „Additive Manufacturing in Construction“ zurück, den sie gemeinsam mit der TU München (Öffnet in einem neuen Tab) betreibt. Ziel ist es nun, diese Grundlagenforschung in reale Anwendungen zu überführen – unter den Bedingungen einer echten Baustelle, mit Wind, Wetter und technischen Herausforderungen.
Mensch und Maschine im Team
Trotz aller Digitalisierung steht der Mensch nicht im Abseits. Im Gegenteil: Die „Digitale Baustelle“ setzt auf das Konzept der „Human-Machine-Collaboration“. Das bedeutet, dass Mensch und Maschine eng verzahnt zusammenarbeiten – etwa bei der Prozessüberwachung oder in der Baustellenplanung. „Wir sprechen bewusst nicht mehr nur von Automatisierung, sondern von Human-Machine-Collaboration“, so Schwerdtner. „Die Produktion muss frühzeitig in der Planung mitgedacht werden. Dafür braucht es interdisziplinäre Kompetenzen.“
Diese Entwicklung erfordert auch neue Qualifikationen: Planerinnen und Planer der Zukunft müssen sich mit Robotik, Datenanalyse und Bauinformatik auskennen. An der TU Braunschweig denkt man daher bereits über neue Studiengänge nach, die klassische Ingenieurwissenschaften mit digitalen Methoden verbinden. „Angesichts des enormen Bau- und Sanierungsbedarfs sowie des Fachkräftemangels führt an Digitalisierung, Automatisierung und neuen Technologien kein Weg vorbei“, stellt Schwerdtner klar.
Ein zentrales Instrument dafür ist das „Digital Engineering Center“. In dieser Schaltzentrale werden alle Daten der Baustelle gesammelt und in ein dreidimensionales Modell integriert. VR- und AR-Anwendungen ermöglichen es, Bauprozesse zu simulieren, visuell zu erfassen und Risiken vorab zu erkennen. „Dreidimensionale Darstellungen mit Terminplänen zu verknüpfen, um Abläufe im Zeitraffer anzuschauen, ist für uns enorm wertvoll“, erläutert Schwerdtner.
Eine Baustelle auch für die Wirtschaft
Die Initiative ist nicht nur ein Forschungsvorhaben, sondern gezielt praxisnah gedacht. Regionale und überregionale Unternehmen aus der Bauwirtschaft sind eingeladen, sich zu beteiligen – als Partner, Tester oder Anwendungsentwickler. Schwerdtner betont: „Wir wollen mit unserem Projekt Möglichkeiten für eine zukünftige Baustelleninfrastruktur aufzeigen.“ Dabei geht es nicht um eine Einheitslösung, sondern um Impulse, die je nach Projekt individuell weiterentwickelt werden können.
Mit rund 3,8 Millionen Euro fördert der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) die Infrastruktur der Digitalen Baustelle – ein klares Zeichen für die strategische Bedeutung des Themas. Schwerdtner ist überzeugt, dass die Bauindustrie am Beginn eines tiefgreifenden Umbruchs steht – technologisch, organisatorisch und auch kulturell: „Wir stehen vor großen Herausforderungen, aber auch vor gewaltigen Chancen. Die Digitalisierung des Bauens eröffnet neue Wege – ökologisch, ökonomisch und sozial.“ Die TU Braunschweig liefert dafür nicht nur die Theorie, sondern ein reales Testfeld, auf dem diese Zukunft bereits beginnt.
Text: Stephen Dietl, 15. Juli 2025