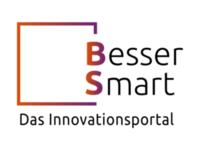Transportable Atomuhren: Einstein auf Rädern
Ein unscheinbarer Anhänger, nicht größer als ein Pferdetransporter, steht vor dem Gebäude der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (Öffnet in einem neuen Tab) (PTB) in Braunschweig. Was von außen wie gewöhnliche Fracht erscheint, birgt im Inneren eines der präzisesten Messgeräte der Welt: eine transportable optische Atomuhr. Unter Leitung von Dr. Christian Lisdat arbeitet ein Forschungsteam an der Weiterentwicklung dieser hochkomplexen Zeitmessgeräte, die nicht nur die Metrologie revolutionieren, sondern auch vielfältige Anwendungen in Geodäsie und Klimaforschung versprechen.
Eine Atomuhr ist kein gewöhnliches Zeitmessgerät. Statt eines mechanischen Pendels oder Quarzoszillators einer Armbanduhr nutzt sie die natürlichen Schwingungen von Atomen als Taktgeber. „Jedes Atom hat ganz eigene Eigenschaften, und jedes chemische Element unterscheidet sich von den anderen“, erklärt Dr. Lisdat. „Besonders spannend sind die Elektronen, die sich in bestimmten, erlaubten Bahnen um den Atomkern bewegen. Diese Bahnen kann man sich wie festgelegte Ebenen vorstellen, auf denen sich die Elektronen aufhalten dürfen. Mithilfe von elektromagnetischer Strahlung – etwa durch Mikrowellen oder Laserlicht – können die Elektronen die Bahn wechseln.“
Die Relativität der Zeit
Was für die Filmhelden im Hollywood Blockbuster „Interstellar“ dramatische Konsequenzen hatte – dass nämlich in der Nähe eines schwarzen Lochs die Zeit langsamer vergeht – findet auch auf der Erde statt, nur in viel kleinerem Maßstab. „Den Effekt aus dem Film gibt es wirklich“, erläutert Lisdat. „Die Zeit vergeht unterschiedlich schnell, je nachdem wie weit weg man sich von einer schweren Masse befindet, zum Beispiel einem Planeten oder einem schwarzen Loch.“ Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt diesen Effekt, der als Gravitationsrotverschiebung bekannt ist: Je näher man sich am Schwerpunkt der Erde befindet, desto langsamer vergeht die Zeit. „Wenn man unsere Atomuhr um einen Meter anhebt, ändert sich die Frequenz um 10-16. Und in den Bergen mit 1000 Metern Höhenunterschied ist das ein Rieseneffekt“, erklärt der Physiker.
Große Herausforderungen im Kleinen
Seit 2012 arbeitet die PTB an einer transportablen Version der Atomuhr. „Als metrologisches Institut baut man traditionell Atomuhren und möchte natürlich sicher sein, dass sie auch richtig gehen. Und das funktioniert am besten, wenn man sie direkt mit einer anderen Uhr vergleicht“, sagt Lisdat. Doch die Entwicklung ist alles andere als einfach. „Optische Atomuhren beinhalten viele Laser, die sehr stabil sein müssen. Sie sind extrem empfindlich gegenüber seismischen Erschütterungen oder Veränderungen der Umgebungstemperatur“, erläutert Lisdat die Herausforderungen.
Nanosekunden auf Reisen
Trotz dieser Herausforderungen kann das Team heute schon beeindruckende Erfolge vorweisen. Kürzlich wurde die transportable Atomuhr gemeinsam mit Kollegen aus Japan in London getestet und mit dortigen stationären Uhren verglichen. Darüber hinaus wurde sie bereits in den französischen Alpen, in Paris und in München eingesetzt. Und bei einem geodätischen Experiment zwischen Braunschweig und München konnte ein Höhenunterschied von etwa 400 Metern mit einer Abweichung von nur 27 Zentimetern zu konventionellen Messungen bestimmt werden – eine bemerkenswerte Leistung, die das Potenzial dieser Technologie unterstreicht.
Die PTB steht mit ihrer Forschung an transportablen Atomuhren international an vorderster Front. „Der Standort der PTB ist schon an sich großartig, weil hier extrem viel Kompetenz und Infrastruktur gebündelt ist“, betont Lisdat. Ergänzt durch Kooperationen mit der TU Braunschweig (Öffnet in einem neuen Tab) und der Universität Hannover (Öffnet in einem neuen Tab) sowie zahlreichen regionalen und auch internationalen Partnern, arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der stetigen Verbesserung ihrer Uhren.
Zukunft der Zeitmessung
„Transportable Atomuhren sind auch interessant für Fragen der Klimaforschung“, erklärt Lisdat. „Wir hoffen, dass sich mit ihnen Höhen langfristig noch genauer bestimmen lassen, um beispielsweise den Anstieg der Meeresspiegel zu beobachten.“ Die zunehmende Miniaturisierung könnte die Technologie zudem für breitere Anwendungen zugänglich machen. „Aktuell hat eine transportable Atomuhr mit allem Zubehör ungefähr die Größe von zwei Kleiderschränken. Das werden wir noch kleiner bekommen“, prognostiziert Lisdat.
Die transportable Strontium-Gitteruhr der PTB strebt langfristig eine Höhenauflösung von unter einem Zentimeter an, was einer relativen Frequenz-Unsicherheit von weniger als 10-18 entspricht. Dies würde präzise Höhenmessungen über große Distanzen ermöglichen – ein entscheidender Vorteil gegenüber herkömmlichen Methoden, die über weite Strecken Fehler akkumulieren.
Die Revolution der Zeitmessung, die in Braunschweig ihren Ausgang nimmt, wird sich vermutlich in den kommenden Jahren in vielen Bereichen unauffällig bemerkbar machen. Während wir die Atomuhr am Handgelenk wohl dennoch nie erleben werden, könnten kompaktere, kommerzialisierte Versionen dieser hochpräzisen Zeitmesser künftig in geodätischen Referenzstationen, Rechenzentren und der Telekommunikation zum Einsatz kommen – und uns auch dabei helfen, die Auswirkungen des Klimawandels besser zu verstehen.
Text: Stephen Dietl, 2. Juli 2025